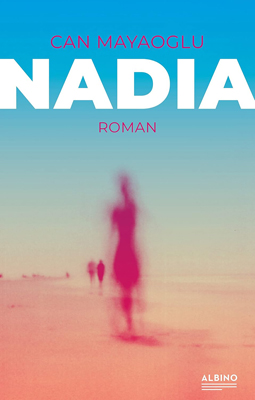
Nadia
Can Mayaoglu
Das spurlose Verschwinden ihrer jüngeren Schwester Dilhan und die Trennung von ihrer großen Liebe Rahel haben der Installationskünstlerin Nadia den Boden unter den Füßen weggezogen. Zwar schafft sie es, den Verlust Dilhans zu einem in aller Welt gefeierten Ausstellungsprojekt zu verarbeiten, doch der Trost, den das Publikum in dem interaktiven Kunstwerk findet, kommt bei Nadia selbst nicht an. Ihr innerer Aufruhr bleibt, der Jetset im Zeichen der Kunst ist mehr Flucht als Therapie. Als sie die Installation erstmals in ihrer Heimatstadt Hamburg präsentieren soll, zählt Nadia darauf, dass ihre jahrelang eingeübten Schutz- und Fluchtmechanismen sie auch diesmal vor aufrüttelnden Konfrontationen bewahren. Doch hier, wo die Traumata ihren Ursprung haben, ist die Vergangenheit unerwartet lebendig, und die Erinnerung stärker als die Verdrängung.Verlag: Albino

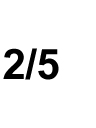
In einem Satz: »Bemühtes Drama um stereotype Figuren, gespickt mit einer wahren Flut von Literatur- und Popkulturreferenzen.«
Eine selbstbemitleidende, sehr erfolgreiche Installationskünstlerin kehrt nach Hamburg zurück, um in den Deichtorhallen zum letzten Mal jenes weltweit gefeierte Werk zu zeigen, mit dem sie das Verschwinden ihrer jüngeren Schwester acht Jahre zuvor verarbeitet hat. Des weiteren lebt in Hamburg auch ihre Ex-Freundin, der sie Jahre nach der Trennung noch immer nachtrauert. An dieser Ausgangslage ändert sich im Verlauf von Nadia kaum etwas, und auch die Protagonistin ist am Ende dieselbe. Diesen Weg zurück zum Ausgangspunkt legt sie großmehrheitlich im Taxi einer Frau mit klischeehaft harter Schale und weichem Kern zurück, die meist bloß einige Minuten entfernt zu sein scheint, wenn die Titelfigur sie braucht. Hamburg ist und bleibt eben ein Dorf.
Manchmal fällt es mir schwer, zu erklären, weshalb ich ein Buch nicht mag, bei Nadia ist dies zum Glück nicht der Fall. Den Anfang macht die Sprache. Nach wenigen Zeilen wird klar, dass dem Text kein angemessenes Lektorat zuteil wurde. Es gäbe viel zu streichen, zu kürzen, zu polieren, aber leider hat sich niemand die Mühe gemacht, der Autorin unter die Arme zu greifen. Ein sorgfältiges Lektorat könnte diesen Text deutlich aufwerten. Für mich liegt es jedoch nicht nur an der Qualität der Sprache, der Stil entspricht einfach nicht meinem Geschmack. Bilder und Metaphern sind für mein Empfinden oft unpassend und schräg, und auch die Geschichte selbst vermag mich nicht zu überzeugen. Versatzstücke aus dem Dramabaukasten werden unbeholfen vermengt, ohne je zu mehr als einer niedergeschriebenen Folge einer Vorabendfernsehserie zu werden.
Hamburg: Um zu belegen, wie gut die Protagonistin die Stadt kennt, werden Straßennamen und Orte erwähnt, als ob es keine Karten gäbe. Wirkt dies zunächst noch bemüht, nervt es nach einer Weile richtig. Ab und zu wird trübes Wetter moniert, das für die Figuren typisch für Hamburg ist, obwohl die Stadt auch nicht mehr Regentage hat als das sonnige München und sogar deutlich weniger als Städte wie Bonn und Köln.
Endgültig verloren hat die Autorin mich mit den endlosen Literatur- und Popkulturreferenzen. Selbstverliebte Feuilleton-Autoren und Autorinnen nerven mit dem Erwähnen großer Dichter und Denker, Trivialliteratur schmückt sich mit Popkultur. Bei Nadia bekommt man beides in einem Buch, und wie jedes Kleinkind weiß, mehr ist mehr. Charakterliche Tiefen werden mit Hilfe von Playlist und Streaming History erklärt. Das ist einfach keine Literatur. Dabei fällt mir noch ein: Wenn man schon ständig aus fremden Werken zitiert, dann doch bitte korrekt. Das Gedicht Do not go gentle into that good night von Dylan Thomas spielt eine wichtige Rolle, und die berühmte Zeile "Rage, rage against the dying of the light" wird ganze vier Mal zitiert, jedes Mal falsch. Bei einem so hohen Preis für ein doch recht schmales Buch darf ein Mindestmaß an Sorgfalt erwartet werden.
Fazit: Sprachlich nicht überzeugend, schablonenhafte Figuren, erkenntnisfrei, Hamburg bleibt Stadtplankulisse. Für mich eine große Enttäuschung, ganz besonders weil es nicht viele neue Romane gibt, die in Hamburg spielen.

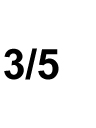
In einem Satz: »Einfache Geschichte erstickt in einer endlosen Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten, erzählt in ermüdender, unfertiger Sprache.«
Für mich war es nicht leicht, mich durch dieses Buch zu kämpfen. Unzählige belanglose Einzelheiten behindern den Lesefluß. Kürzen, der Albtraum aller Autoren, die Pflicht der Lektorinnen. Zu Beginn habe ich mich mit der Hoffnung motiviert, später mit überraschenden Einblicken und Erkenntnissen belohnt zu werden, doch im letzten Drittel beginnt man zu ahnen, dass nichts mehr kommen wird, und das macht das Weiterlesen unheimlich schwer. Die Protagonistin wirkt unecht, die Taxifahrerin, die sie durch die Geschichte chauffiert, ist ein Klischee und wird dann auch noch liebevoll nach einer lesbischen Kommissarin aus einer amerikanischen Uraltfernsehserie benannt, was wohl irgendwie cool sein soll. Große Literatur entsteht, wenn jemand eine Geschichte erzählen muss und deswegen ein Buch schreibt. Eher selten klappt es, wenn jemand ein Buch schreiben will, aber keine Geschichte zu erzählen hat, und so kommt es mir bei Nadia vor. Nie spürt man die Dringlichkeiten echter Leben, alles wirkt überzeichnet und konstruiert.
Ich habe mir überlegt, was den Roman für mich interessanter machen könnte. Was wäre, wenn bei jeder Taxifahrt jemand anderes auf dem Fahrersitz säße? Eine Geflüchtete aus Afghanistan? Ein alter Mann am Ende eines langen Taxifahrerlebens? Eine übernächtigte Medizinstudentin? Ein erfolgloser Künstler? Diese unterschiedlichen Menschen könnten die Situation der Protagonistin aus einer Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven beleuchten. Wäre das nicht viel spannender als das überholte Klischee der gutherzigen, grobschlächtigen Butch, die immer genau die Ratschläge erteilt, die man erwartet?
Etwas in diesem Buch hat mir jedoch auch gefallen, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen. In Nadia kommen Männer ziemlich gut weg, und das ist heutzutage alles andere als selbstverständlich. Dass mir das überhaupt aufgefallen ist, zeigt, wie sehr auch ich selbst die Vorverurteilung meines Geschlechts in der westlichen Gegenwartskultur verinnerlicht beziehungsweise akzeptiert habe.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dieses Buch womöglich einfach nicht verstanden habe, dass sich etwas von Belang darin verbirgt, das sich mir entzieht. Es könnte die Beziehung der Protagonistin zu ihrer älteren Schwester sein. Ich wäre nicht überrascht, wenn andere das Buch interessant finden, und deshalb möchte ich Nadia mit neutralen drei Punkten bewerten.
Fazit: Ich kann mit diesem Buch nichts anfangen, aber andere könnten womöglich mehr darin finden. Wer sich vom Klappentext angesprochen fühlt, sollte einfach mal reinlesen.

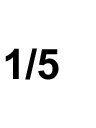
In einem Satz: »Gedankenwelt einer Dramakönigin verpackt in einen Roman ohne Entwicklung, vollgepackt mit Titeln von Liedern, Filmen, Fernsehserien und tausend alltäglichen Banalitäten.«
In diesem Buch werden berühmte Installationskünstlerinnen von Männern mit Penthouse in Anzügen aus der Savile Row in Jaguar F-Type Coupés in Portofino Blue aus dem Designer-Hotel The George abgeholt, danach wird der Wagen "geschmeidig" durch den dichten Abendverkehr zum Frischeparadies gelenkt, wo Austern zur Abholung bereitliegen. Autotüren werden "aufgeklappt", Möwen schwingen tanzend durch den Himmel, Proust-Zitate erreichen die Protagonistin per Sprachnachricht in Madrid. Brauche ich mehr zu sagen? Für mich ist so etwas, um es mal in der Fremdsprache auszudrücken, die dieses vermeintlich deutschsprachige Buch von Anfang bis Ende erbarmungslos heimsucht, cringe to the max. Diesen Roman bevölkern privilegierte Menschen mit normalen Problemen, die sich selbst für ziemlich wichtig halten. Literatur kann vieles sein, intelligent, unterhaltend, tiefgründig, poetisch, provozierend, ich nehme alles, aber diese Erzählung ist ganz einfach Puppentheater. Weshalb um Himmels willen sollten wir uns für diese narzisstischen Pappfiguren und ihre unbeholfenen und wenig erhellenden Versuche, das Leben zu meistern, interessieren?
Fazit: Ein Buch für Männer mit Sportwagen in Portofino Blue.
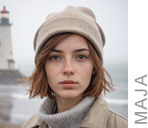
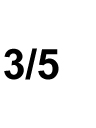
In einem Satz: »Eine 264-Seiten Spotify-Playlist, angereichert mit konstruiertem Drama um langweilige Menschen, die sich für den Mittelpunkt der Welt halten.«
In diesem Buch wird alles durch Verweise auf andere Werke erklärt. Unzählige Zitate, Filme, Serien und Lieder sollen uns Figuren, Stimmungen und Gefühlswelten näher bringen. Vielleicht müsste man all diesen Verweisen nachgehen, um dieses Buch zu verstehen. Ich habe dies nicht getan, weil ich einfach keine Lust habe, mir jede halbe Seite einen Song anzuhören, bevor ich weiterlesen kann, und um mir während der Lektüre ganze Filme und Serien anzusehen, bin ich erst recht zu faul. Um in die Welt eines Buches einzutauchen, muss ich ganz einfach lesen können, möglichst ohne Ablenkungen und Unterbrüche.
Inhaltlich bietet Nadia so einiges auf, um für Konflikte und innere Spannungen zu sorgen. Eine vermutlich wegen Drogen verschwundene Schwester, ein Seitensprung in einer angeblich ganz großen Liebesbeziehung, ein nicht geteilter Kinderwunsch und eine Frau, die über Jahre hinweg sowohl ihren Mann wie auch seinen Bruder liebt und auch mit beiden das Bett teilt. Das klingt nach Seifenoper, und so liest es sich auch. Das würde ich nicht grundsätzlich als negativ bewerten, Drama gehört zu Unterhaltung, und Unterhaltung ist nichts Schlechtes, aber das Verhängnis der verschwundenen Schwester hat mich gestört, weil man über die Drogenproblematik in diesem Roman rein gar nichts lernen kann, sie ist bloß Mittel zum Zweck, ein einfacher Weg, um eine Figur zu Fall zu bringen. All das Elend, die Verzweiflung und das Leid, das mit harten Drogen einhergeht, sind kein Thema in Nadia. Hier fühlen sich Geschwister ein bisschen schuldig, weil sie sich fragen, ob ihnen nicht hätte auffallen müssen, dass die jüngste Schwester häufig lange Ärmel trägt.
Ich habe mir überlegt, weshalb ich schon nach ungefähr einem Drittel eine ziemlich starke Abneigung gegen dieses Buch entwickelt habe. Ein Teil davon ist sicherlich, dass es durch die ausschweifenden Berichte langweiligster Alltagsbanalitäten und die vielen Verweise unheimlich mühsam zu lesen ist, aber die Tatsache, dass die Figuren ziemlich unsympatisch sind, trägt wohl auch ihren Teil dazu bei. Auch die Bildsprache ist nicht mein Ding. Es gibt jede Menge blumige Metaphern, aber kaum eine passt. Es ist, als ob man einfach mal ein paar Wörter und Ausdrücke vermischt hätte, die normalerweise nicht zusammen verwendet werden. Da eckt man an, aber interessant oder gar Literatur ist das deswegen noch nicht.
Nun zu Hamburg: Unzählige Straßen, Gebäude, Orte, Nahrungsmittel und vieles mehr werden erwähnt, aber für die Geschichte spielt das keine Rolle. Würde man all dies durch entsprechende Begriffe aus Berlin ersetzen, wäre das Buch kein bisschen anders.
Meine Bewertung habe ich nachträglich um einen Punkt angehoben, weil es meine Entscheidung war, die ganzen Lieder zu ignorieren, obwohl ich mir durchaus vorstellen kann, dass ein Buch durch passende Hintergrundmusik aufgewertet werden könnte, bei Filmszenen ist das ja auch so. Ich finde bloß, dass ein literarisches Werk ohne fremde Hilfe funktionieren sollte.
Fazit: Ich habe keinen Zugang zu diesem Buch gefunden und würde es nicht weiterempfehlen.